"Die Ausbildung in klinischer Forschung muss gründlicher und systematischer werden."
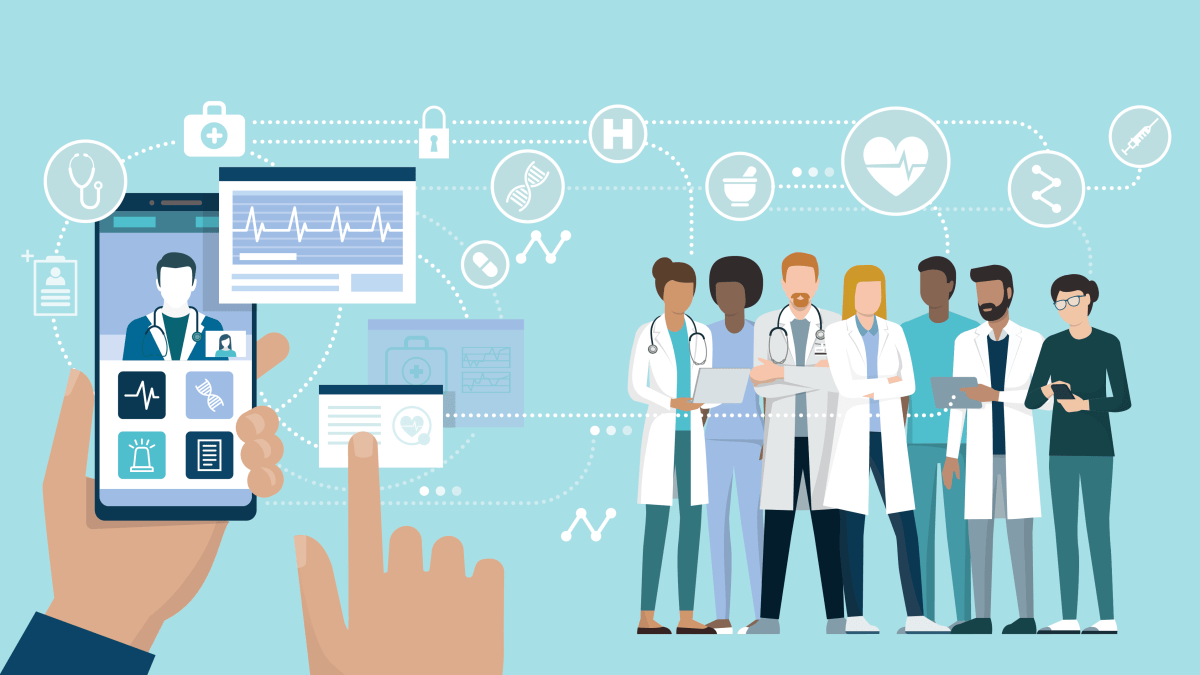
© elenabsl - stock.adobe.com
"Die klinische Forschung ist kein Karriere-Killer. Es gibt in Deutschland, unter anderem an der Charité, international renommierte Meinungsführer in klinischen Fragestellungen. Trotzdem: Die Ausbildung in klinischer Forschung, insbesondere in der Methodik, muss gründlicher und systematischer werden."

Das Interview führte Beate Achilles im Oktober 2008.
Eine Kurzfassung wurde in der E-Health-COM Nr. 6 2008 veröffentlicht.
Herr Professor Einhäupl, seit bald zehn Jahren sind Sie Sprecher des Kompetenznetzes Schlaganfall, vor kurzem ist an der Charité das interdisziplinäre Centrum für Schlaganfallforschung gestartet, an dem Sie maßgeblich beteiligt sind. Warum ist Ihnen die Forschungsarbeit über Standorte und Fachgebiete hinweg so wichtig?
Forschung ist ein internationales Geschäft, und Innovationen entstehen häufig an den disziplinären Grenzen. Da man nicht überall gleichzeitig sein kann, ist schon deshalb Vernetzung unumgänglich. Allgemein entsteht durch Netzwerke einfach eine Community, die das ganze Gebiet stärkt und sich für das Thema Wissenschaft konzentriert einsetzen kann. Dies gilt für die klinische, epidemiologische und translationale Forschung gleichermaßen.
Beispiele für vernetzte Forschung an der Charité sind unter anderem das Integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum Centrum für Schlaganfall-Forschung Berlin (CSB), das BCRT oder die elf Sonderforschungsbereiche. Dort ist unser Haus mit den verschiedensten Einrichtungen vernetzt, etwa mit anderen - auch nicht universitären - Kliniken, mit extrauniversitären Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen, Krankenkassen und Institutionen aus dem Public-Health Bereich.
Was müsste sich strukturell – organisatorisch und technisch – ändern oder weiterentwickeln, damit Forschungsfragestellungen schnell und effizient geklärt werden können?
Zunächst einmal braucht man gute Leute. Um diese adäquat ausstatten und bedienen zu können – denn sonst kriegen Sie die guten Leute nicht - sind entsprechende finanzielle Mittel nötig. Technisch halte ich es für wichtig, vor allem teure Einrichtungen wie Kernspintomographen oder PET1 Facilities, aber auch Sequenzer und ähnliche Geräte für Forscher besser zugänglich zu machen. Die Privatisierung solch teurer Facilities ist heute nicht mehr zeitgemäß.
Im Juni 2008 haben Sie den Vorstandsvorsitz der Berliner Charité übernommen. Welche Allianzen werden Sie schmieden oder ausbauen? Zu anderen Unikliniken, zu nicht-akademischen Krankenhäusern, zu niedergelassenen Ärzten, vielleicht auch zu Patientenorganisationen?
Die Charité will die reiche Forschungslandschaft Berlins nutzen und künftig enger mit den außeruniversitären Forschungsgemeinschaften, wie etwa Helmholtz-, Max-Planck- und Leibniz-Gemeinschaft, aber auch in Teilbereichen mit der Fraunhofer-Gesellschaft kooperieren.
Einen guten Kontakt zu niedergelassenen Ärzten in Berlin haben wir bereits durch unseren Fortbildungsbereich. Ein großer Teil der Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte im Raum Berlin findet an der Charité statt. Mit Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen, z. B. in meinem Fachgebiet den Schlaganfall- und Aphasie-Gesellschaften, aber auch Gruppierungen im Bereich ALS, Multiple Sklerose etc. sind wir bereits gut vernetzt.
Für die „Karriere“ als Arzt oder Forscher gilt die klinische Forschung bisher häufig noch als Sackgasse. Was ist Ihre Vision für den wissenschaftlichen Nachwuchs?
Zunächst möchte ich dem widersprechen: Die klinische Forschung ist kein Karriere-Killer. Es gibt in Deutschland, unter anderem an der Charité, international renommierte Meinungsführer in klinischen Fragestellungen. Trotzdem: Die Ausbildung in klinischer Forschung, insbesondere in der Methodik, muss gründlicher und systematischer werden. Ein Curriculum mit klar definierten Ausbildungsstufen, wie in den USA, wäre auch hierzulande wünschenswert.
Ferner ist es wichtig, durch gezielte Berufung von Juniorprofessorinnen und – professoren den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielt zu fördern. Die Charité ist eine der medizinischen Einrichtungen Deutschlands, die das Konzept der Juniorprofessur am stärksten umsetzt. Auch in Gleichstellungsthemen nehmen wir eine Vorbildfunktion ein.
Wo bleibt der Patient in einem so komplexen und vernetzten System, das medizinische Versorgung und Forschung zur Aufgabe hat? Was ist sein Vorteil, wenn er in einer Uniklinik wie der Charité behandelt wird?
Der Vorteil einer Universitätsklinik ist, dass sie exzellente Medizin bietet und Sie dort ein hohes Maß an sehr spezialisierter Kompetenz finden. In der Neurologie der Charité etwa gibt es ca. 14 Oberärzte, und jeder ist auf seinem Gebiet ein Spezialist. Dort hat er eine enorme Wissenstiefe und das kommt natürlich den Patienten zugute.
Außerdem profitieren die Patienten in einer Universitätsklinik von den neuesten und innovativsten Methoden, die dort häufig früher etabliert sind als an nicht universitären Einrichtungen. Aber das Wichtigste für mich als Leiter der Charité ist, dass unser Haus mit all seinem Personal, vom Pförtner bis zum Klinikdirektor, dem Patienten das Gefühl von Geborgenheit und Zuwendung gibt. Mir scheint, das gelingt uns auch.
Herr Prof. Einhäupl, wir bedanken uns für das Gespräch.
Weiterführende Informationen


