Daten retten Leben – Digitalisierung in Gesundheitswesen und medizinischer Forschung tut not
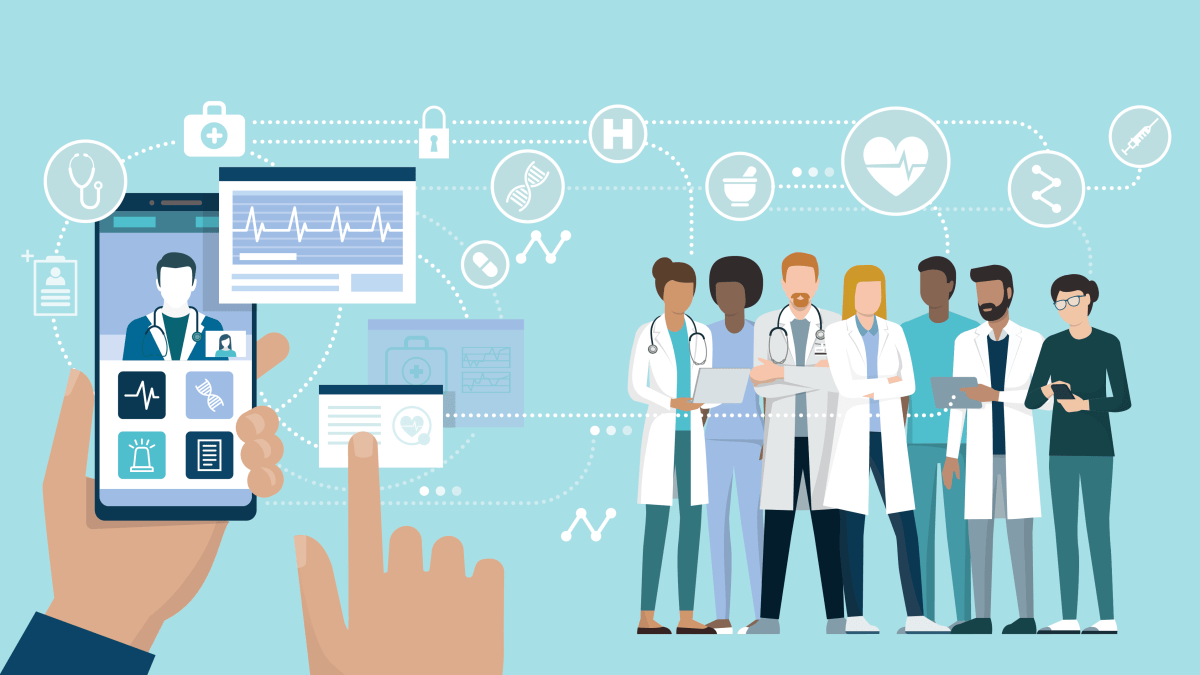
© elenabsl - stock.adobe.com
In einem am 16. Juli 2019 im Tagesspiegel Background veröffentlichten Gastbeitrag betont Sebastian C. Semler die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen und der medizinischen Forschung, insbesondere in Hinblick auf die elektronische Patientenakte (ePA). Er zeigt die gegenwärtig noch bestehenden Defizite in der Digitalisierung unseres Gesundheitssystems auf und skizziert die notwendigen Schritte, um aus einer elektronischen Sammelmappe eine forschungskompatible digitale Patientenakte zu machen, die einen Mehrwert für alle schafft.

Sebastian C. Semler, Geschäftsführer der TMF. © TMF e.V.
Am vergangenen Mittwoch lag dem Bundeskabinett der Entwurf des Digitale-Versorgung-Gesetzes aus der Feder der agilen Digitalisierungsabteilung des Bundesministeriums für Gesundheit zur Beschlussfassung vor. Damit legt das Ressort von Bundesminister Spahn weiter Tempo vor. Zuvor hatte das Bundesjustizministerium mit der Blockade der Kabinettsbefassung gedroht, sollte es nicht weitreichende datenschutzrechtliche Änderungen an einem zentralen Bestandteil des Gesetzes geben. Um nicht an Fahrt zu verlieren, hatte der Minister statt zur Notbremse zur Waggonkupplung gegriffen. So kam es, dass das vorgesehene Update für die elektronische Patientenakte (ePA), eigentliches Herzstück der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens, an diesem Morgen im Kanzleramt nicht zur Entscheidung anstand.
Mit dem ursprünglich geplanten neuen §291h SGB V, der die Regelungen zur elektronischen Patientenakte bündeln sollte, verschwand auch ein unscheinbarer Passus aus dem Gesetzentwurf, der das Potential hat, nicht weniger als eine Transformation unseres Gesundheitswesens zu initiieren. Worum geht es?
Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, die gematik als Betreiberin der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen zu beauftragen, bis zum 30. Juni 2021 die notwendigen Spezifikationen zu erarbeiten, damit Bürgerinnen und Bürger ihre Gesundheitsdaten nicht nur verbindlich in einer ePA verfügbar haben, sondern auch aus der ePA für Forschungszwecke zur Verfügung stellen können. Gemeinhin firmiert dies unter dem ebenso eingängigen wie rechtlich unscharfen Begriff der „Datenspende“.
Nun ist eine technische Schnittstelle noch lange keine vernetzte Forschungsdateninfrastruktur. Auch sind Fragen der rechtlichen Qualität der „Datenspende“ zu klären, so zum Beispiel wann die Daten anonymisiert werden und wer als vertrauenswürdiger Datentreuhänder auftritt. Und doch zeigt der nun vorübergehend aufgeschobene gesetzliche Auftrag, dass es die Bundesregierung ernst meint mit dem letztjährig in der Hightech-Strategie formulierten Ziel, bis zum Jahr 2025 forschungskompatible elektronische Patientenakten im Einsatz zu haben – und dem Bürger und Patienten mehr Steuerungsmöglichkeiten zu geben, an medizinischer Forschung teilzunehmen und diese zum Wohle Aller zu unterstützen.
Nicht nur elektronische Sammelmappen schaffen – Digitalisierung muss unser Gesundheitssystem intelligenter machen
Es stimmt: Der Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen ist im Vergleich zu anderen Branchen noch rückständig. Und in keinem Gesundheitssystem der Welt wird noch so viel gefaxt wie in Deutschland. Wenn digital dokumentiert wird, dann erfolgt dies häufig unstrukturiert und freitextlich. All das wird dann zum Problem, wenn wir aus Daten der Diagnostik und der Behandlung aus vielen Einrichtungen zusammenführen und analysieren wollen, um neue Zusammenhänge für personalisierte Therapien zu erkennen oder schlicht und ergreifend Qualität und Effektivität der realen Situation in der Patientenversorgung zu überprüfen. Erst recht werden wir scheitern, wenn wir die Versprechen der Künstlichen Intelligenz ernst nehmen und Algorithmen entwickeln wollen, die beispielsweise eine beginnende Sepsis noch vor deren klinischen Beginn zu erkennen vermögen oder diagnostische Bilder automatisiert analysieren sollen.
Wir müssen uns daher stärker von den Papieranalogien lösen: Wenn Deutschland als Forschungs- und Entwicklungsstandort eine gute Rolle spielen soll, wenn Patientinnen und Patienten nicht nur durch ein Weniger an Bürokratie, sondern eben vor allem durch ein Mehr an Gesundheit von der Digitalisierung profitieren sollen, dann muss die ePA mehr sein als eine „elektronische Blattsammlung“. Niemand hat einen gesteigerten Mehrwert, wenn er sich, statt durch abgeheftete Zettel zu blättern, nunmehr durch unstrukturierte Scans oder digitale Dokumente scrollt. Wir müssen unser Gesundheitswesen vielmehr durch die Digitalisierung intelligenter machen, um die wahren Potenziale zu heben.
Damit dies alles funktioniert, auch im marktwirtschaftlichen Wettbewerb um die beste Datenaufbereitung und Datennutzungen, brauchen wir strukturierte und einheitlich codierte Daten in der ePA. Das heißt: Kein „dummes“ PDF des Laborbefundes mit Kreuzchen für erhöhte Werte, sondern die strukturierte und automatisiert auslesbare Angabe, welcher Wert, nach welcher Methode, in welchem Medium, wann im Verhältnis zu welchem Referenzbereich gemessen wurde. Erst dann können Werte verglichen, Kurven gezeichnet und neue Erkenntnisse gewonnen werden.
Die digitale Rendite braucht politisches Kapital
Die Wahrheit ist: Täglich sterben bei uns Menschen, weil entweder nicht alle für ihre bestmögliche Behandlung relevanten Informationen zeitnah verfügbar sind oder weil neuartige Therapien nicht entwickelt werden können. Die Bundesregierung hat zu Beginn der Legislaturperiode eine Datenethikkommission eingesetzt. Sie wird im Herbst ihren Abschlussbericht vorlegen. Eine Antwort auf eine zentrale Frage ist sicher: Es gibt den Bedarf, Daten von Patienten vor Missbrauch zu schützen – nicht aber vor wertvollem Gebrauch. Es gibt vielmehr eine ethische Pflicht zur Datennutzung, damit auch zur Datenbereitstellung und -teilung, wenn so Leben gerettet werden können. In einem lernenden Gesundheitssystem dokumentiert der Einzelne nicht nur für sich und seine Bedürfnisse, sondern eben auch für die Solidargemeinschaft.
Die Akzeptanz der neuen digitalen Gesundheitswelt in den Praxen, Arzt- und Pflegezimmern wird ganz maßgeblich davon abhängen, dass sie zur Effizienz der Abläufe beiträgt und keine neuen Aufwände schafft. Doch damit intelligente Assistenzsysteme zur Datenerfassung, aber auch zur Diagnoseunterstützung per Künstlicher Intelligenz verfügbar werden können, braucht es für deren Entwicklung große, qualitätsgesicherte Datenkörper, an denen Algorithmen trainiert und qualitätsgesichert werden können. Das gilt in der Medizin genauso wie in anderen Bereichen - sonst schauen wir in der Medizin wie ein Satellit auf die Erde und können ohne Kenntnis der realen Bedingungen nicht das Rapsfeld vom Sonnenblumenmeer unterscheiden.
Wir sollten deshalb zweierlei tun: Die technischen Voraussetzungen für eine bestmögliche Datenerfassung und -weitergabe ohne Informationsverluste schaffen und zugleich Anreizsysteme für eine vertiefte, standardisierte Primärdokumentation durch ein Netzwerk der Forschungspraxen und -kliniken gesetzlich verankern. Neben Zusatzvergütungen ist insbesondere Ausbildung und Datenkurartion durch „Data Stewards“ zu investieren.
Gegenwärtig werden im Rahmen der Medizininformatik-Initiative (MII) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) hierfür wichtige Grundlagen gelegt: Im ersten Schritt bauen die Universitätsklinika derzeit deutschlandweit an über 30 Standorten gemeinsam mit weiteren außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Industriepartnern Datenintegrationszentren auf und entwickeln Lösungen für ersten konkreten Anwendungsfälle. Ziel ist es, Forschungs- und Versorgungsdaten standortübergreifend zu verknüpfen und für die medizinische Forschung zu erschließen. Für Forschung und Patientenversorgung wichtige infrastrukturelle Impulse werden auf diesem Wege erreicht, wie ein standortübergreifender Kerndatensatz, Datenstandardisierung mit internationalen Terminologien und Ordnungssystemen und bundesweit einheitliche rechtlich-ethische Konzepte zur Patienteneinwilligung. Dies muss sektorübergreifend ausgeweitet und nutzbar gemacht werden. Damit alle Akteure des Gesundheitswesens in den Gesundheitsdaten eine einheitliche Sprache sprechen, müssen wir jetzt handeln und übergreifende Festlegungen zu Datenstrukturen, zu technischen Schnittstellen sowie zu semantischen Inhalten der medizinischen Daten treffen. Sonst droht ein babylonisches Sprachgewirr: Jeder will miteinander sprechen, aber niemand versteht sich.
Wir brauchen hierfür eine übergreifende Koordinierung, die die gemeinsame Strategieentwicklung vorantreibt und daraus Festlegungen ableitet. Wir brauchen ein Miteinander, keine Vorgartenpflege oder Nabelschau. Zuletzt haben Verbände und Kassenärztliche Bundesvereinigung erklärt, gemeinsam und vertrauensvoll an der inhaltlichen Struktur der ePA arbeiten zu wollen. Man sollte sich gegenseitig beim Wort nehmen.
Medizinische Forscher sollten nicht länger wie Schatzsucher oder Feldarchäologen arbeiten müssen
Über die brachliegenden Chancen der Routinedaten unseres Gesundheitssystems ist viel und mit Recht geklagt worden. Da ist einerseits von noch zu hebenden Datenschätzen die Rede. Andererseits heißt es, die ePA könne zum Datengrab werden. Beides ist nicht falsch. Doch ist jetzt die Zeit, miteinander konkret zu werden: Weder können wir es uns leisten, Forscherinnen und Forscher erst auf Schatzsuche durch den Irrgarten des deutschen Gesundheitswesens mit seinen zig burgähnlich abgeschotteten Datenspeichern zu schicken, noch können sie auf Dauer wie bei historischen Ausgrabungen mit hohem Aufwand jede verwertbare Information einzeln freilegen. Wenn wir als Forschungs- und Entwicklungsstandort wettbewerbsfähig bleiben wollen, wenn wir für unsere Bevölkerung die Möglichkeiten der personalisierten Medizin der Zukunft erschließen wollen, dann brauchen wir für Forschende wirkungsvolle Forschungsdateninfrastrukturen, die – im Sinne einer One-Stop-Agency – einen effektiven, sicheren Zugang auf von den Patientinnen und Patienten bereitgestellte hochqualitative Forschungsdaten ermöglichen. Mit einem Antrag, einem deutschlandweiten Kerndatensatz. Und nach einheitlichen Datenschutzstandards.
Mit der Ausgliederung des Rechtsrahmens der Datenhaltung in der ePA in ein eigenes Gesetz haben wir die Gelegenheit, die wirkliche digitale Transformation des Gesundheitssystems zu beginnen. Mit einer für alle Beteiligten anschlussfähigen Forschungsdatenschnittstelle, klaren Vorgaben zur Anwendung von internationalen Standards, einem funktionalen Datenschutz und der Incentivierung einer guten Datenqualität wird aus der elektronischen Sammelmappe eine forschungskompatible digitale Patientenakte, die echten Mehrwert für uns alle schafft.
Sebastian Claudius Semler ist approbierter Arzt mit Fachzertifikat Medizinische Informatik. Nach langjähriger Lehrtätigkeit an der Freien Universität Berlin bzw. Charité Berlin und beruflichen Stationen in der IT-Industrie (als Consultant und leitender Produktmanager im Bereich Elektronische Patientenakte, digitale Archivierung und Labordatenmanagement) ist er seit 2004 wissenschaftlicher Geschäftsführer der gemeinnützigen Dachorganisation TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. In dieser Funktion ist er u.a. Mitglied des Beirates der gematik und leitet die Koordinierungsstelle der Medizininformatikinitiative (MII) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Darüber hinaus ist Sebastian C. Semler seit vielen Jahren in unterschiedlichen nationalen und internationalen Fachinitiativen und Standardisierungsgremien aktiv, u.a. aktuell als ehrenamtlicher Geschäftsführer von IHE Deutschland.


