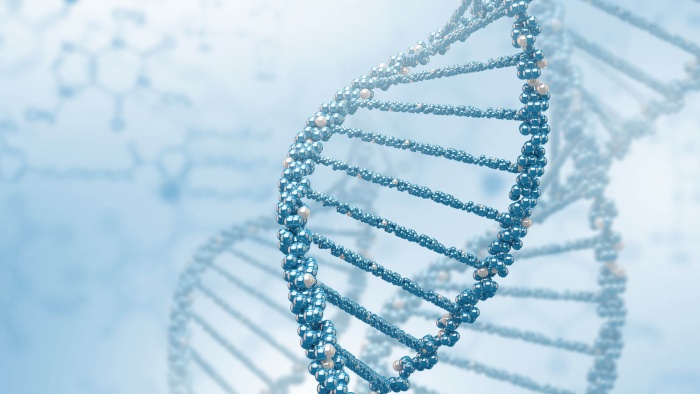„Es zeigen sich ganz überraschende Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Krankheitsbildern“
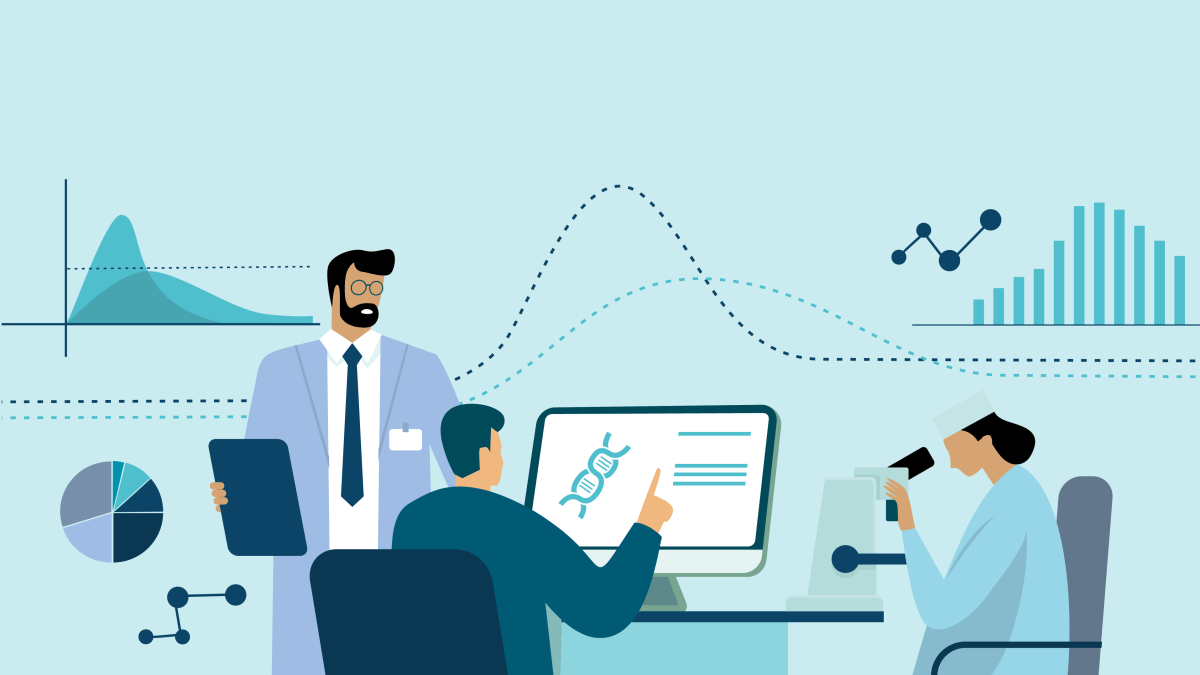
© Zubada - stock.adobe.com
Prof. Dr. Roland Jahns ist Direktor der Interdisziplinären Biomaterial- und -Datenbank Würzburg (ibdw) und stellvertretender Vorsitzender der Ethik-Kommission bei der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg. Außerdem arbeitet er in der Arbeitsgruppe Biobanken des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen mit. Im Gespräch mit der TMF im Rahmen des 2. Nationalen Biobanken-Symposiums 2013 berichtet er über die ethischen Herausforderungen der modernen Biobanken-Forschung und über die Entwicklung vom informed zum broad consent.

Prof. Dr. Roland Jahns
Herr Professor Jahns, wie sind Sie dazu gekommen, sich so intensiv mit ethischen Fragen zu beschäftigen?
Ich bin vor fast zehn Jahren eher so in das Thema hineingerutscht, als unsere Ethik-Kommission einen Kardiologen als Fachgutachter brauchte. In der Arbeit in dieser noch jungen und sehr dynamischen Kommission habe ich gesehen, welche ethischen Konflikte manchmal auftreten können und wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Etwas später habe ich dann selbst Studienkonzepte mit den zugehörigen Informations- und Einwilligungsunterlagen entwickelt und sozusagen am eigenen Leibe erlebt, woran man alles denken muss. Da in einer der Studien auch Biomaterialien gesammelt wurden, habe ich angefangen, mich auch dafür mit den erforderlichen Einwilligungsmaterialien zu beschäftigen.
Als dann die Ausschreibung des BMBF kam für die zentralisierten Biobanken, konnten wir auf diesen Erfahrungen bereits aufbauen. Ab dem Zeitpunkt haben wir uns auch in der Ethikkommission mit dem Thema intensiv beschäftigt. Uns war klar, dass wir uns etwas überlegen müssen, wenn wir Biomaterialien prospektiv sammeln wollen für einen Forschungszweck, den wir heute noch gar nicht wissen können. Dazu haben wir ethische Grundsatzdiskussionen geführt, auch schon bevor der Deutsche Ethikrat 2010 seine Stellungnahme zu dem Thema veröffentlicht hat.
In dieser Zeit bin ich auch auf die TMF und ihre unterstützenden Dokumente gestoßen. Letztlich aber, und das ist das Spannende, ist es dann doch die Kommission, die in intensiven Diskussionen mit den unterschiedlichsten Standpunkten sich gemeinsam zu irgendwas durchringt. Ich habe in der Zeit die Ethik-Kommission für ein Jahr geleitet und habe mich sehr intensiv in die Literatur eingearbeitet. Darüber bin ich dann auch vorgeschlagen worden für diese Arbeitsgruppe Biobanken beim Arbeitskreis medizinischer Ethik-Kommissionen.
Was sind denn heute die großen ethischen Herausforderungen an die Biobanken-Forschung?
Schwierig ist, wie gesagt, die prospektive Sammlung von Materialien. Für retrospektive Nutzung von Proben oder Altmaterialien gibt es etablierte Lösungen. Wenn die Patienten gebeten werden, in die Nutzung der Materialien für ein spezifisches Projekt nach entsprechender Aufklärung einzuwilligen, stimmen die Ethik-Kommission in der Regel zu.
Aber wenn ich prospektiv sammele, kann ich dem Patienten zum Zeitpunkt der Probenentnahme noch nicht sagen, was wir damit machen wollen. Gerade bei Fakultäts-übergreifenden Biobanken wie den zentralisierten Biobanken wird man die künftige Forschung nicht einmal auf ein bestimmtes Indikationsgebiet beschränken wollen. Warum sollte ich denn dem Psychiater die Möglichkeit vorenthalten, Herzinfarktseren zu untersuchen oder umgekehrt? Wir haben dafür neue Texte für die Information und Einwilligung des Patienten erarbeitet. Es gibt aber immer noch Diskussionen hierzu, und es ist schwierig, alle Vorbehalte abzubauen.
Ein weiteres großes Problem ist der Umgang mit Zufallsbefunden. Auch der Arbeitskreis medizinischer Ethik-Kommissionen befasst sich ja mit diesem Thema. Ich denke da beispielsweise an psychiatrische Forschung, die heute immer mehr en vogue ist. Bisher wissen wir bei 90 Prozent aller Befunde aus der Gendiagnostik noch nicht, ob sie wirklich klinisch relevant sind. Wenn wir aber die genetischen Determinanten haben, wie gehe ich dann beispielsweise mit der Information um, dass bei einem Probanden vielleicht eine gewisse Tendenz besteht, eine Schizophrenie, eine Depression oder Alzheimer zu entwickeln?
Bisher basierte die Einwilligung der Patienten auf dem Prinzip des informed consent. Dieser wird nun zu einem broad oder open consent weiterentwickelt. Was bedeutet das?
Das Problem des informed consent ist, dass man genau beschreiben muss, was man mit den Materialien und Daten machen will. Das fordern wir in der Ethik-Kommission in der Regel, wenn Blut im Rahmen von industriellen klinischen Studien beiseite gelegt werden soll – auch die Pharmaindustrie legt immer häufiger selbst kleine Biomaterialsammlungen an – denen versuchen wir schon zu sagen, sie sollen sich beschränken auf ihr Indikationsgebiet.
Aber wir sammeln ja – und das macht eine Biobank wertvoll – über zehn, zwanzig Jahre Biomaterial und zugehörige klinische Daten. Wenn wir dann irgendeinen neuen oder einen noch sensitiveren Biomarker entdecken, können wir in unserer Sammlung retrospektiv den Wert dieses Markers überprüfen.
Broad consent oder open consent sind praktisch Synonyme für eine nicht eng gefasste Einwilligung. Das heißt, dass ich gar nicht sage, in welche Richtung mit diesem Material geforscht wird – ob das nun ein Onkologe untersuchen wird oder ein Kardiologe und mit welchem Ziel, das soll offen sein. Es zeigen sich ja ganz überraschende Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Krankheitsbildern. Um diese zu entdecken, weiter zu erforschen und möglichst für die Diagnose und Therapie nutzbar zu machen, ist ein broad consent notwendig.
Das erfordert auf der anderen Seite – und darauf hat auch der Deutsche Ethikrat hingewiesen – eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen. Ein wesentliches Element ist die jederzeitige Widerrufbarkeit. Dabei müssen wir sicherstellen, dass wir die Materialien eines Patienten oder Probanden auch wirklich vernichten können, wenn er widerruft. IT-technisch ist das ziemlich aufwändig.
Auch Transparenz ist wichtig. Für uns bedeutet das vor allem, im Rahmen der Außendarstellung zu zeigen, welche Forschungsprojekte wir bearbeiten. Es geht dabei vor allem um Glaubwürdigkeit, damit der Spender sicher ist und darauf vertrauen kann, dass mit seinem Material etwas Vernünftiges gemacht wird.
Der Spender muss auch wissen, dass Sicherungsmaßnahmen da sind wie eine Ethik-Kommission. Wir sammeln ja erst mal unter einem broad consent, aber die Herausgabe wird dann jeweils für ein spezifisches Forschungsprojekt von der Ethik-Kommission und von einem Fachgremium geprüft.
Das sind die Schutzmechanismen, die um einen solchen broad consent gebaut werden müssen. Wir haben versucht, dies im Arbeitskreis medizinischer Ethik-Kommissionen abzustimmen und im Mustertext einen kleinsten gemeinsamen Nenner formuliert, mit dem sich alle Ethik-Kommissionen einverstanden erklären können. Das ist in Deutschland völliges Neuland.
Welche Schritte haben Sie mit Ihrer Biobank in Würzburg bisher unternommen, um Transparenz herzustellen und Vertrauen zu gewinnen?
Wir haben es zum Beispiel geschafft, einen Tag der offenen Biobanken zu veranstalten mit relativ gutem, aber natürlich lokalem Zuspruch. Wir waren auf Messen vertreten, auch wirklich mit sehr viel Resonanz am Stand, eher in die Gefahr laufend, dass viele dann spontan Proben spenden wollten, was in unserem speziellen Fall so nicht funktioniert, da wir nur Proben aus unserem Klinikkontext sammeln.
Ich bin aber der Meinung, dass diese Öffentlichkeitsarbeit schon im Vorfeld einer Erkrankung der Menschen einsetzen muss. Und insofern ist es unser Ehrgeiz, überhaupt erst einmal bekannt zu machen, was eine Biobank ist, was die Ziele sind, was das eventuell später mal bringen kann – Schlagwort spezifischere Therapien, möglicherweise weniger Nebenwirkungen oder auf mich zugeschnittene Therapien, die besonders gut bei mir wirken aufgrund meines Biomarker-Profils. Ich glaube schon, dass sich langfristig daraus extreme individuelle Vorteile ergeben. Das muss man versuchen zu transportieren.
Ich fange jetzt persönlich schon an mit Schulklassen, wo wir uns vor allem an Oberstufenschüler und ihre Lehrer richten. Wir überlegen jetzt sogar, einen Parcours auszuarbeiten, mit kleinen Aufgaben. Das war ein Vorschlag von der Lehrerschaft selber.
Auf jeden Fall sollte der Wissensstand der Bevölkerung über solche Biobanken dringend erhöht werden. Mit dem besseren Wissen können insbesondere auch Ängste abgebaut werden. Das geht nur über Transparenz und den Aufbau einer Vertrauensbeziehung.
Die Forderung geht ja noch weiter: Biobanken sollten Probanden als Ko-Manager ihrer Daten begreifen. Ist das realistisch und wie könnte das aussehen?
Bei der UK Biobank geht es zum Beispiel immerhin so weit, dass der Proband sehen kann, welche Projekte mit seinen Biomaterialien arbeiten. Der Spender kann sich bei der Biobank einloggen und zumindest schon mal sehen, wo und wie das Material verwendet wird. Das ist bei einer Biobank im klinischen Kontext schon viel schwieriger, und wir sind auch noch lange nicht so weit.
Allerdings zu fordern, dass der Patient oder Proband dann für jedes dieser Projekte spezifisch einwilligen muss, ist aus meiner Sicht logistisch überhaupt nicht zu stemmen. Ich glaube, das sprengt auch den Rahmen selbst von sehr interessierten und informierten Patienten. Dafür gibt es letztendlich auch die Gremien innerhalb einer Biobank, die interdisziplinär zusammengesetzt sind, die auch Laienmitglieder haben und die prüfen, ob ein bestimmtes Forschungsprojekt die Proben nutzen darf. Die Ethik-Kommission versteht sich sozusagen als Schutzwall vor dem Patienten, und da muss der Patient dann schon drauf vertrauen.
Wenn man davon ausgeht, dass der Proband oder Patient möglicherweise doch gar nicht alles bis ins letzte Detail wissen möchte, dann könnte man dem Argument folgen, auf der Makroebene nicht zu viel zu regeln, sondern das dem Aushandeln zwischen Biobank und Spender zu überlassen…
Das ist völlig richtig. Im Grunde brauchen wir überhaupt keinen informed consent. Der Spender kann eigentlich selber entscheiden, bis zu welchem Grad er überhaupt informiert werden will und auch, ob er eine Rückmeldung haben will. Es gibt ja das Grundrecht auf Nichtwissen, und das müssen wir natürlich auch gewährleisten. Das Problem ist auch hier wieder ein Logistisches.
Im Mustertext der Arbeitsgruppe Biobanken des Arbeitskreises medizinischer Ethik-Kommissionen empfehlen wir, dass Biobanken ihr Konzept – also wie eng oder breit der consent gefasst ist – von ihrer Ausrichtung abhängig machen. Damit gibt der Mustertext die Möglichkeit der Varianz in den Konzepten der Biobanken vor. Eine Biobank, die sehr spezifisch aufgestellt ist, könnte die Einwilligung eher auf das Forschungsgebiet beschränken, aber zum Beispiel die zentralisierten Biobanken, die ja gerade die Aufgabe haben, fächerübergreifende Konzepte für die gesamte Fakultät zu erarbeiten, wäre eine solche Begrenzung nicht sehr sinnvoll. Und der Spender wahrt seine Autonomie, indem er einer Nutzung seiner Materialien zu den jeweiligen Bedingungen zustimmt – oder eben nicht.
Herr Jahns, wir danken für das Gespräch.
Das Interview führte Antje Schütt.