Aus der Krise lernen: Die Digitalisierung in der medizinischen Forschung nachhaltig gestalten
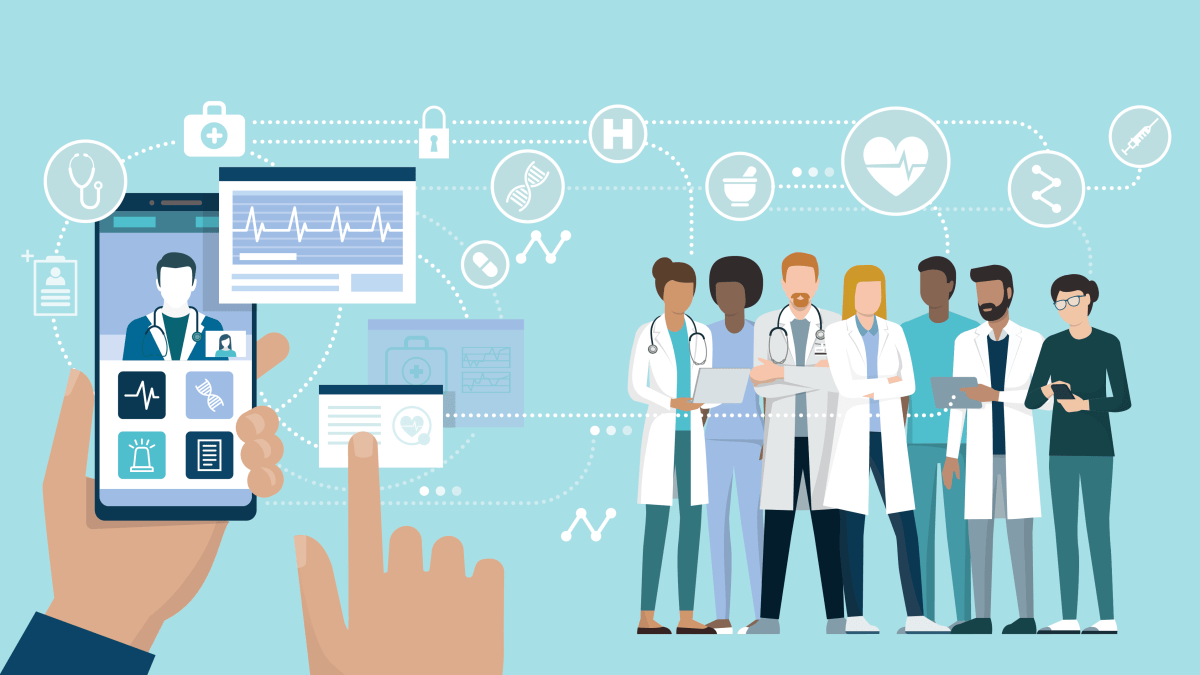
© elenabsl - stock.adobe.com
In einem am 25. Mai 2020 im Handelsblatt Digital Health erschienenen Meinungsbeitrag betont TMF-Geschäftsführer Sebastian C. Semler den in der akuten COVID-19-Pandemie erneut zu Tage getretenen Bedarf einer ad hoc-verfügbaren bundesweiten medizinischen Forschungsinfrastruktur, stellt aktuelle Fortschritte der Medizininformatik-Initiative auf diesem Weg vor und skizziert die Bedingungen für ein Ökosystem der Gesundheitsforschung, das uns stärker aus der Krise herauskommen lässt.

Sebastian C. Semler, Geschäftsführer der TMF. © TMF e.V.
Die aktuelle COVID-19-Krise hat uns allen eindrucksvoll Versäumnisse vor Augen geführt und einige Erkenntnisse verdeutlicht: Die Datenlage für Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitssteuerung und medizinische Forschung ist unvollkommen bis schlecht. Dies liegt heute allerdings nicht mehr daran, dass zu wenig digital dokumentiert wird und Daten nicht existent wären. Vielmehr liegt patientenbezogene Dokumentation zu wenig strukturiert, zu wenig standardisiert und vor allem viel zu fragmentiert vor. Unterschiedliche Zuständigkeiten, z. B. in den verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens und zwischen Bund und Ländern, und ein stark verteilter Rechtsrahmen behindern einen durchgängigen Blick auf Patientenverläufe, Versorgungsprozesse und Meldedaten. So können patientenbezogene Daten aus technischen und aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht über die Grenzen von Standorten hinweg verknüpft werden. Ohne die gegenwärtige Quasi-Notstandsgesetzgebung sind selbst staatliche Stellen zuweilen durch die eng gefassten Nutzungszwecke zu stark eingegrenzt, um unvorhergesehene Fragen bearbeiten und beantworten zu können.
Diese Situation resultiert wohlgemerkt nicht daraus, dass besorgte Bürger ihren Ärzten und der öffentlich finanzierten medizinischen Forschung misstrauten. Das Gegenteil ist der Fall: Eine von der TMF - Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung in Auftrag gegebene FORSA-Umfrage erbrachte im vergangenen Spätsommer ein eindeutiges Ergebnis: Mehr als drei Viertel (79 Prozent) der Deutschen sind bereit, ihre Gesundheitsdaten anonym und unentgeltlich für die medizinische Forschung zur Verfügung zu stellen. Darunter würde eine Mehrheit die Daten zeitlich unbegrenzt bereitstellen, knapp drei Viertel mindestens für die nächsten fünf Jahre. Worin liegt also das Problem? Gesetzliche Regelungen in den einschlägigen Sozialgesetzbüchern definieren Verwendungszwecke abschließend und sahen bislang eine darüberhinausgehende Einwilligungsmöglichkeit des Patienten gar nicht vor. Zudem stand ein föderaler Flickenteppich der Landesdatenschutzaufsicht und landesrechtlicher Vorschriften einer einheitlichen, rechtssicheren Nutzung der im Kontext der Patientenversorgung angefallenen Daten entgegen.
Für die medizinische Forschung in Deutschland wurde nun nach gut zweijährigen intensiven Gesprächen zwischen der vom Bundesforschungsministerium geförderten Medizininformatik-Initiative und der Bundesdatenschutzkonferenz ein Durchbruch erzielt: Ab sofort gibt es einen bundesweit einheitlichen Mustertext für Einwilligungserklärungen der Patienten. Diese können nun aktiv ihre Einwilligung dafür geben, dass ihre Behandlungsdaten, die routinemäßig im Versorgungsalltag erhoben werden, pseudonymisiert für die medizinische Forschung genutzt werden dürfen, und zwar - erstmalig auf Basis der EU-Datenschutzgrundverordnung – nicht nur spezifisch für eine Studie oder ein Krankheitsbild, sondern für breite Zwecke der medizinischen Forschung und Versorgung (sog. „Broad Consent“). Dies ist essentiell, um die vorhandenen Daten auch für unvorhergesehene Fragestellungen nutzen zu können und kommt gerade rechtzeitig, um die akut notwendige Forschung zu COVID-19 zu unterstützen. Das plötzliche Auftreten von COVID-19 und die Entwicklung des Kenntnisstandes zu diesem Krankheitsbild von der viralen Pneumonie zu einer Multiorganerkrankung illustrieren diesen Bedarf. Die Einigung auf eine einheitliche Patienteneinwilligung ist ein wichtiges Signal für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Wissenschaftsstandorts Deutschland.
Es ist daher auch richtig und wichtig, dass die Bundesregierung im 1. Pandemieschutzgesetz die föderale Datenschutzpraxis durch Einführung eines Federführungsprinzips operativ gestrafft hat und in ihrem Entwurf des Patientendaten-Schutz-Gesetzes auch die Daten der künftigen elektronischen Patientenakte der medizinischen Forschung einwilligungsbasiert zugänglich macht. Auch die vorgesehenen Regelungen für mehr Datenstandardisierung zeigen in die richtige Richtung. In beiden Bereichen hat sich in den letzten drei Jahren in Deutschland viel bewegt – aber die Corona-Krise hat auch wie ein Brennglas verdeutlicht, dass wir die Versäumnisse zweier Dekaden noch nicht aufgeholt haben. Verfügbarkeit, Verknüpfbarkeit und Verwertbarkeit bereits vorhandener Daten im Gesundheitssystem in sicheren, öffentlich kontrollierten Systemen für die medizinische Forschung auf Basis einer Einwilligung und unter Einbeziehung der Bürger und Patienten – hierzu bedarf es weiterer intensiver Anstrengungen und Investitionen.
Apropos – auch hierzu kann man wichtige Lehren aus dem pandemischen Geschehen ziehen: Schlagartig wurde klar, wie relevant die enge Anbindung medizinischer Forschung an Patientenversorgung und Gesundheitsüberwachung ist. Medizinische Forschung unterliegt im Vergleich zu anderen Forschungsbereichen ganz eigenen Rahmenbedingungen und Bedarfslagen. Dies ist beim Ausbau digitaler Forschungsinfrastrukturen zwingend zu beachten. Wer etwas für die Digitalisierung der medizinischen Forschung tun will, muss in der Patientenversorgung und deren Dokumentation anfangen. Und dabei möglichst – nach dem „Single Source“ Prinzip – die Nachnutzbarkeit von medizinischen Daten für unterschiedliche Zwecke, auch für noch nicht bekannte Fragestellungen, im Auge haben. Denn ein weiterer Schluss ist aus der Corona-Krise unausweichlich: Für strategische Infrastrukturentscheidungen ist die akute Notlage stets ein schlechter Ratgeber. Es erscheint schwer vorstellbar, dass wir auch auf künftige pandemische Herausforderungen – ganz zu schweigen von den endemisch vorhandenen Volkserkrankungen – mit ad-hoc-Investitionen vergleichbarer Größenordnung reagieren können. Es ist schlicht nicht zielführend, für einzelne Krankheiten teure neue Datensilos zu schaffen. Stattdessen sind Investitionen in planvolle digitale Forschungsinfrastrukturen erforderlich, die helfen, auf künftige Krankheitsgeschehen besser reagieren zu können. In der Akutsituation Entstandenes gilt es zu einem nachhaltigen Ökosystem der Gesundheitsforschung zusammenzufügen, das das Vertrauen der Patienten verdient und Mehrwert für die Menschen in unserem Land schafft. Es ist die gemeinsame Aufgabe von Forschenden und Politik, heute die Grundlagen für das lernende Gesundheitssystem von morgen zu legen.
Sebastian Claudius Semler ist approbierter Arzt mit Fachzertifikat Medizinische Informatik und nach Stationen in Forschung & Lehre und in der IT-Industrie seit 2004 Geschäftsführer der TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. in Berlin. Er leitet seit 2016 die Koordinationsstelle der Medizininformatik-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Eigene Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Datenstandardisierung und Terminologien sowie Rechts- und Organisationsfragen zur Digitalisierung in der medizinischen Forschung und Versorgung. Semler wirkt weiterhin als Fachgutachter, ist Mitglied im Beirat der gematik sowie ehrenamtlicher Geschäftsführer von IHE Deutschland.


